Am Abend des 18. Dezember 2004 wanderte ein Mann namens Jean-Luc Josuat-Vergès im Weiler Madiran im Südwesten Frankreichs in die Tunnel einer verlassenen Pilzfarm und verirrte sich. Der 48-jährige Josuat-Vergès, der als Hausmeister in einem örtlichen Gesundheitszentrum arbeitete, war deprimiert. Er hatte seine Frau und seinen 14-jährigen Sohn zu Hause gelassen und war mit einer Flasche Whiskey und einer Tasche voller Schlaftabletten in die Berge gefahren. Nachdem er seinen Land Rover in den großen Eingangstunnel der Pilzfarm gelenkt hatte, knipste er seine Taschenlampe an und stolperte in die Dunkelheit.
Die Tunnel, die ursprünglich als Kreidemine in die Kalksteinhügel gegraben worden waren, bildeten ein fünf Kilometer langes Labyrinth aus blinden Gängen, gewundenen Passagen und Sackgassen. Josuat-Vergès ging einen Korridor entlang, drehte sich um, drehte sich wieder um. Die Batterie seiner Taschenlampe wurde langsam schwächer, dann war sie leer; kurz darauf wurden ihm, als er einen durchnässten Gang hinunterstapfte, die Schuhe von den Füßen gesaugt und vom Schlamm verschluckt. Josuat-Vergès stolperte barfuß durch das Labyrinth, tastete im Stockdunkeln und suchte vergeblich nach dem Ausgang.
Am Nachmittag des 21. Januar 2005, genau 34 Tage nachdem Josuat-Vergès zum ersten Mal die Tunnel betreten hatte, beschlossen drei einheimische Teenager, die verlassene Pilzfarm zu erkunden. Schon nach wenigen Schritten in den dunklen Eingangskorridor entdeckten sie den leeren Land Rover, dessen Fahrertür noch offen stand. Die Jungen riefen die Polizei, die sofort einen Suchtrupp losschickte. Nach 90 Minuten fanden sie Josuat-Vergès in einer Kammer, nur 600 Meter vom Eingang entfernt. Er war gespenstisch blass, dünn wie ein Skelett, und ihm war ein langer, struppiger Bart gewachsen – aber er lebte.
In den folgenden Tagen, als die Geschichte von Josuat-Vergès‘ Überleben die Medien erreichte, wurde er als le miraculé des ténèbres, „das Wunder der Dunkelheit“ bekannt.“
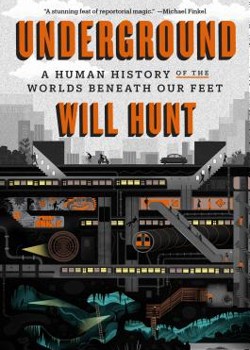
Er verwöhnte Reporter mit Geschichten aus seinen Wochen in der Pilzfarm, die selbst den großartigsten Erzählungen von gestrandeten Bergsteigern oder Schiffbrüchigen auf einsamen Inseln Konkurrenz zu machen schienen. Er aß Lehm und verrottetes Holz, das er fand, indem er auf allen Vieren kroch und im Schlamm herumstocherte; er trank Wasser, das von der Kalksteindecke tropfte, und saugte manchmal sogar Wasser von den Wänden. Wenn er schlief, wickelte er sich in alte Plastikplanen ein, die die Pilzzüchter zurückgelassen hatten. Der Teil von Josuat-Vergès‘ Geschichte, der die Reporter verwirrte, war, dass er radikalen und unerwarteten Stimmungsschwankungen unterlag.
Weitere Geschichten
Zeitweise versank er, wie zu erwarten, in tiefer Verzweiflung; aus einem Stück Seil, das er fand, machte er sogar eine Schlinge, „für den Fall, dass die Dinge unerträglich würden“. Aber in anderen Momenten, so Josuat-Vergès, wenn er durch die Dunkelheit lief, verfiel er in eine Art meditative Ruhe, ließ seine Gedanken weich werden und sich entfalten, während er die Gefühle der Orientierungslosigkeit umarmte und sich in friedlicher Gelöstheit durch die Tunnel treiben ließ. Während er stundenlang durch das Labyrinth wanderte, sagte er: „Ich sang zu mir selbst in der Dunkelheit.“
Homo sapiens waren schon immer wunderbare Navigatoren. Wir besitzen ein leistungsfähiges Organ in der primitiven Region unseres Gehirns, dem Hippocampus, wo bei jedem Schritt eine Million Neuronen Daten über unseren Standort sammeln und das zusammenstellen, was Neurowissenschaftler als „kognitive Karte“ bezeichnen, die uns immer die Orientierung im Raum gibt. Dieser robuste Apparat, der unsere modernen Bedürfnisse bei weitem übersteigt, ist ein Erbe unserer nomadischen Jäger- und Sammlervorfahren, deren Überleben von der Fähigkeit zur Navigation abhing. Hunderttausende von Jahren lang führte das Versagen, eine Wasserstelle oder einen sicheren Felsunterschlupf zu finden, Wildherden zu folgen und essbare Pflanzen zu lokalisieren, zum sicheren Tod. Ohne die Fähigkeit, uns durch unbekannte Landschaften zu lotsen, hätte unsere Spezies nicht überlebt – sie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Menschlichkeit.
Lesen Sie: Wenn das Gehirn keine eigenen Landkarten erstellen kann
Kein Wunder also, dass wir, wenn wir die Orientierung verlieren, in eine urtümliche, bitterböse Panik verfallen. Viele unserer elementarsten Ängste – von geliebten Menschen getrennt zu sein, von zu Hause entwurzelt, im Dunkeln gelassen zu werden – sind Abwandlungen der Angst vor dem Verlorengehen. In unseren Märchen wird die holde Maid, wenn sie im düsteren Wald die Orientierung verliert, von einem bedrohlichen Troll oder einem vermummten alten Weib angegriffen. Selbst die Hölle wird oft als Labyrinth dargestellt, was auf Milton zurückgeht, der den Vergleich im verlorenen Paradies anstellte. Die archetypische Horrorgeschichte der Orientierungslosigkeit ist der griechische Mythos des Minotaurus, der in den gewundenen Falten des Labyrinths von Knossos haust, einer Struktur, die, wie Ovid schrieb, „gebaut wurde, um Ungewissheit zu verbreiten“, um den Besucher „ohne einen Bezugspunkt“ zurückzulassen.
So tief sitzt unsere Furcht vor Orientierungslosigkeit, dass das Verirren eine Art Zusammenbruch auslösen könnte, bei dem unser Selbstverständnis aus den Fugen gerät. „Einem Mann, der daran nicht gewöhnt ist“, schrieb Theodore Roosevelt 1888 in seinem Buch „Ranch Life and the Hunting Trail“, „scheint das Gefühl, sich in der Wildnis zu verirren, ihn in einen Zustand panischen Schreckens zu versetzen, der furchtbar anzusehen ist und ihn am Ende seiner Vernunft beraubt … Wenn er nicht innerhalb von drei oder vier Tagen gefunden wird, ist er sehr geneigt, verrückt zu werden; er wird dann vor den Rettern fliehen und muss verfolgt und gefangen werden, als wäre er ein wildes Tier.“
Vom ersten Schritt in die unterirdische Dunkelheit an fällt unser Hippocampus, der uns so zuverlässig durch die Oberflächenwelt führt, aus, wie ein Radio, das den Empfang verloren hat. Wir sind abgeschnitten von der Führung durch die Sterne, von Sonne und Mond. Selbst der Horizont verschwindet – wäre da nicht die Schwerkraft, könnten wir kaum zwischen oben und unten unterscheiden. Alle subtilen Anhaltspunkte, die uns an der Oberfläche orientieren könnten – Wolkenformationen, Pflanzenwuchsmuster, Tierspuren, Windrichtung – verschwinden. Unter der Erde verlieren wir sogar die Orientierung durch unseren eigenen Schatten.
Unten in einem engen Höhlengang oder in den begrenzten Falten einer Katakombe ist unser Blickfeld eingeschränkt und reicht nie über die nächste Biegung oder den nächsten Knick hinaus. Wie der Höhlenforscher William White feststellte, sieht man nie eine ganze Höhle, sondern immer nur einen Splitter. Wenn wir durch eine Landschaft navigieren, schrieb Rebecca Solnit in A Field Guide to Getting Lost, lesen wir unsere Umgebung wie einen Text, studieren „die Sprache der Erde selbst“; der Untergrund ist eine leere Seite, oder eine Seite, die mit einer Sprache gekritzelt ist, die wir nicht entziffern können.
Lesen: Terra incognita
Nicht, dass sie für jeden unlesbar wäre. Bestimmte unterirdisch lebende Lebewesen sind auf wunderbare Weise daran angepasst, sich im Dunkeln zurechtzufinden. Wir alle kennen die Fledermaus, die mit Hilfe von Sonar und Echoortung durch die Dunkelheit der Höhlen stürzt, aber der Meister der unterirdischen Navigation ist vielleicht der blinde Maulwurf: eine rosa, faltige, bucklige Kreatur – stellen Sie sich einen 90-jährigen Daumen mit Reißzähnen vor -, die ihre Tage in riesigen, labyrinthartigen unterirdischen Nestern verbringt. Um sich in diesen dunklen Gängen zurechtzufinden, trommelt die blinde Maulwurfsratte regelmäßig mit dem Kopf auf den Boden und erkennt dann die Form des Raums anhand der Muster der zurückkehrenden Vibrationen. In ihrem Gehirn hat die Ratte sogar ein winziges Eisendepot, einen eingebauten Kompass, der das Magnetfeld der Erde aufspürt. Die natürliche Auslese hat uns Oberflächenbewohner nicht mit solchen adaptiven Tricks ausgestattet. Für uns ist ein Schritt unter die Erde immer ein Schritt in ein navigatorisches Vakuum, ein Schritt in die falsche Richtung, oder besser gesagt, in gar keine Richtung.
In jeder anderen Landschaft, wenn unsere angeborenen Navigationsfähigkeiten versagen, wenden wir uns an eine Karte, die uns im Raum verankert und uns auf Kurs hält. In der unterirdischen Welt jedoch war die Kartierung schon immer ein einzigartiges, verwirrendes Unterfangen. Lange nachdem Entdecker und Kartographen jede andere irdische Landschaft auf dem Planeten kartiert hatten und saubere Breiten- und Längslinien über ferne Inselgruppen und Gebirgsketten legten, blieben die Räume direkt unter unseren Füßen schwer fassbar.
Die früheste bekannte Karte einer Höhle wurde 1665 von der Baumannshöhle gezeichnet, einer großen Höhle in der dicht bewaldeten Harzregion in Deutschland. Nach den rudimentären Linien der Karte zu urteilen, scheint der Kartograph, ein Mann, der als von Alvensleben identifiziert wird, kein erfahrener oder gar fähiger Kartograph gewesen zu sein, aber die Unzulänglichkeiten der Karte sind dennoch bemerkenswert. Der Entdecker hat es versäumt, ein Gefühl für Perspektive, Tiefe oder eine andere Dimension zu vermitteln – er hat es nicht einmal geschafft, zu kommunizieren, dass der Raum unterirdisch ist. Von Alvensleben versuchte, einen Raum zu kartographieren, den er neurologisch nicht sehen konnte, einen Raum, der buchstäblich außerhalb seiner Wahrnehmung lag. Es kam zu einer erkenntnistheoretischen Torheit, wie der Versuch, ein Porträt eines Geistes zu malen oder eine Wolke in einem Netz zu fangen.
Die Karte der Baumannshöhle war die erste in einer langen Reihe von kuriosen Fehlschlägen der unterirdischen Kartographie. Über Generationen hinweg stiegen Forscher in ganz Europa in Höhlen ein, um die unterirdische Welt zu vermessen und sich in der Dunkelheit zu orientieren – und scheiterten oft auf verblüffende Weise. An ausfransenden Seilen ließen sie sich tief in die Erde hinab, wo sie stundenlang umherirrten, über riesige Felsbrocken kletterten und in unterirdischen Flüssen schwammen. Als Wegweiser dienten Wachskerzen, die schwache Lichtkränze abgaben, die nicht weiter als ein paar Meter in jede Richtung reichten. Oft griffen die Forscher zu absurden Maßnahmen, wie zum Beispiel ein österreichischer Forscher namens Joseph Nagel, der, um eine Höhlenkammer zu beleuchten, ein Gestell mit Kerzen an die Füße von zwei Gänsen band und dann Kieselsteine auf die Gänse warf, in der Hoffnung, dass sie die Flucht ergreifen und ihr Licht in die Dunkelheit werfen würden. (Es funktionierte nicht: Die Gänse wackelten lahm und purzelten auf die Erde.)
Selbst wenn es ihnen gelang, Messungen durchzuführen, war die räumliche Wahrnehmung der Forscher durch die Launen der Umgebung so verzerrt, dass ihre Ergebnisse weit daneben lagen. Auf einer Expedition in Slowenien im Jahr 1672 lotete ein Forscher zum Beispiel einen gewundenen Höhlengang aus und gab dessen Länge mit sechs Meilen an, obwohl er in Wirklichkeit nur eine Viertelmeile zurückgelegt hatte. Die Vermessungen und Karten, die aus diesen frühen Expeditionen hervorgingen, wichen oft so stark von der Realität ab, dass einige Höhlen heute praktisch nicht mehr zu erkennen sind. Heute können wir die alten Berichte nur noch als kleine, geheimnisvolle Gedichte über imaginäre Orte lesen.
Der berühmteste der frühen Höhlenforscher war ein Franzose namens Edouard-Alfred Martel, der als Vater der Höhlenforschung bekannt wurde. Im Laufe seiner fünf Jahrzehnte währenden Karriere leitete Martel etwa 1.500 Expeditionen in 15 Ländern der Welt, hunderte davon in unberührte Höhlen. Der gelernte Anwalt verbrachte seine ersten Jahre damit, sich in Hemdsärmeln und mit einer Schiebermütze abzuseilen, bevor er schließlich eine spezielle Höhlenausrüstung entwarf. Neben einem zusammenklappbaren Boot aus Segeltuch, das er Alligator nannte, und einem klobigen Feldtelefon, mit dem er mit den Trägern an der Oberfläche kommunizieren konnte, entwickelte er eine Reihe von unterirdischen Vermessungsinstrumenten. So erfand er zum Beispiel eine Vorrichtung zur Vermessung einer Höhle vom Boden bis zur Decke, bei der er einen alkoholgetränkten Schwamm an einer langen Schnur an einem Papierballon befestigte und dann ein Streichholz an den Schwamm hielt, wodurch der Ballon bis zur Decke aufstieg, während er die Schnur abwickelte. Martels Karten mögen präziser gewesen sein als die seiner Vorgänger, aber im Vergleich zu den Karten, die von Entdeckern anderer Landschaften zu dieser Zeit angefertigt wurden, waren sie kaum mehr als Skizzen. Martel wurde für seine kartografische Innovation gefeiert, eine Höhle in verschiedene Querschnitte (oder Coupes) zu unterteilen, was zum Standard in der Höhlenkartierung werden sollte.
Lesen Sie: Wie digitale Karten verändert haben, was es bedeutet, verloren zu sein
Martel und seine Forscherkollegen, die jahrelang versuchten, sich in der unterirdischen Welt zu orientieren und dabei scheiterten, waren Jünger der Verlorenheit. Keiner kannte die sinnliche Erfahrung der Orientierungslosigkeit so genau: Stundenlang schwebten sie durch die Dunkelheit, gefangen in einem anhaltenden Schwindelzustand, während sie versuchten und scheiterten, sich zu verankern. Nach aller evolutionären Logik, in der unser Verstand so verdrahtet ist, dass er Orientierungslosigkeit um jeden Preis vermeiden will, in der Verlorenheit unsere primitivsten Angstrezeptoren aktiviert, müssen sie eine tiefe Angst erlebt haben: „der panische Schrecken, der furchtbar anzusehen ist“, wie Roosevelt es beschrieb. Und doch gingen sie immer wieder unter.
Sie schöpften eine Form von Kraft, so scheint es, aus dem Sich-Verlieren in der Dunkelheit.
Die Verlorenheit war schon immer ein rätselhafter und vielseitiger Zustand, immer gefüllt mit unerwarteten Potenzen. Im Laufe der Geschichte haben Künstler, Philosophen und Wissenschaftler aller Couleur die Desorientierung als Motor für Entdeckungen und Kreativität gefeiert, sowohl im Sinne des Verlassens eines physischen Weges als auch im Sinne der Abkehr vom Vertrauten und der Hinwendung zum Unbekannten.
Um große Kunst zu machen, sagte John Keats, müsse man sich auf die Desorientierung einlassen und sich von der Gewissheit abwenden. Er nannte dies „negative Fähigkeit“: „Das heißt, wenn ein Mensch fähig ist, in Ungewissheiten, Mysterien, Zweifeln zu sein, ohne reizbar nach Fakten und Vernunft zu greifen.“ Auch Thoreau beschrieb Verlorenheit als Tor zum Verständnis des eigenen Platzes in der Welt: „Erst wenn wir uns völlig verirrt oder umgedreht haben“, schrieb er, „erkennen wir die Weite und Fremdartigkeit der Natur … Erst wenn wir uns verirrt haben, mit anderen Worten, erst wenn wir die Welt verloren haben, beginnen wir, uns selbst zu finden und zu begreifen, wo wir sind und wie unendlich groß unsere Beziehungen sind.“ All das macht neurologisch gesehen Sinn: Wenn wir uns verirrt haben, ist unser Gehirn am offensten und aufnahmefähigsten.
In einem Zustand der Orientierungslosigkeit saugen die Neuronen in unserem Hippocampus hektisch jedes Geräusch, jeden Geruch und jeden Anblick in unserer Umgebung auf und suchen nach jedem Datenstrang, der uns hilft, uns wieder zu orientieren. Selbst wenn wir uns ängstlich fühlen, wird unsere Vorstellungskraft ungeheuer aktiv und zaubert verschnörkelte Bilder aus unserer Umgebung hervor. Wenn wir im Wald eine falsche Abzweigung nehmen und den Weg aus den Augen verlieren, nimmt unser Verstand jedes Knacken von Zweigen und jedes Rascheln von Blättern als die Ankunft eines wütenden Schwarzbären, eines Rudels Warzenschweine oder eines Sträflings auf der Flucht wahr. Genauso wie sich unsere Pupillen in einer dunklen Nacht weiten, um mehr Lichtphotonen zu empfangen, öffnet sich unser Geist für die Welt, wenn wir uns verirrt haben.
In den späten 1990er Jahren verfolgte ein Team von Neurowissenschaftlern die Kraft der Desorientierung bis in die physischen Anlagen unseres Gehirns. In einem Labor an der University of Pennsylvania führten sie Experimente an buddhistischen Mönchen und Franziskanerinnen durch, bei denen sie deren Gehirne während der Meditation und des Gebets scannten. Sofort fiel ihnen ein Muster auf: Im Zustand des Gebets zeigte eine kleine Region nahe der Vorderseite des Gehirns, der hintere obere Scheitellappen, einen Rückgang der Aktivität. Wie sich herausstellte, arbeitet dieser Lappen bei den Prozessen der kognitiven Navigation eng mit dem Hippocampus zusammen. Soweit die Forscher sehen konnten, ging die Erfahrung spiritueller Gemeinschaft untrennbar mit der Abstumpfung der räumlichen Wahrnehmung einher.
Es sollte also nicht überraschen, dass Anthropologen eine Art Kult der Verlorenheit aufgespürt haben, der sich durch die religiösen Rituale der Welt zieht. Der britische Gelehrte Victor Turner beobachtete, dass jeder heilige Initiationsritus in drei Phasen abläuft: Separation (der Eingeweihte verlässt die Gesellschaft und lässt seinen früheren sozialen Status zurück), Transition (der Eingeweihte befindet sich mitten im Übergang von einem Status zum nächsten) und Inkorporation (der Eingeweihte kehrt mit einem neuen Status in die Gesellschaft zurück). Der Dreh- und Angelpunkt liegt in der mittleren Phase, die Turner das Stadium der Liminalität nennt, vom lateinischen limin, was „Schwelle“ bedeutet. Im liminalen Zustand ist „die Struktur der Gesellschaft selbst vorübergehend außer Kraft gesetzt“: Wir schweben in der Ambiguität und Vergänglichkeit, wo wir weder die eine noch die andere Identität sind, nicht mehr, aber auch noch nicht. Der ultimative Katalysator der Liminalität, schreibt Turner, ist die Desorientierung.
Unter den vielen Ritualen der Verlorenheit, die von Kulturen auf der ganzen Welt praktiziert werden, wird ein besonders ergreifendes von den Pit River Native Americans in Kalifornien beobachtet, wo von Zeit zu Zeit ein Mitglied des Stammes „auf Wanderschaft geht“. Laut dem Anthropologen Jaime de Angulo „meidet der Wanderer, Mann oder Frau, Lager und Dörfer, bleibt an wilden, einsamen Orten, auf den Gipfeln der Berge, in den Tiefen der Schluchten.“ Indem er sich der Orientierungslosigkeit hingibt, sagt der Stamm, hat der Wanderer „seinen Schatten verloren“. Es ist ein wechselhaftes Unterfangen, auf Wanderschaft zu gehen, eine Praxis, die zu unrettbarer Verzweiflung oder sogar Wahnsinn führen kann, aber auch große Kraft bringen kann, da der Wanderer aus der Verlorenheit mit einer heiligen Berufung auftaucht, bevor er als Schamane zum Stamm zurückkehrt.
Das allgegenwärtigste Vehikel der rituellen Verlorenheit – die grundlegendste Verkörperung der Desorientierung – ist das Labyrinth. Wir finden labyrinthische Strukturen in jedem Winkel der Welt, von den Hügeln in Wales über die Inseln im Osten Russlands bis zu den Feldern in Südindien. Ein Labyrinth funktioniert als eine Art Liminalitätsmaschine, eine Struktur, die entwickelt wurde, um eine konzentrierte Erfahrung der Desorientierung zu erzeugen. Wenn wir die gewundenen Steinpassagen betreten und unseren Fokus auf den begrenzten Pfad richten, lösen wir uns von der äußeren Geografie und gleiten in eine Art räumliche Hypnose, in der alle Bezugspunkte wegfallen. In diesem Zustand sind wir bereit, eine Transformation zu durchlaufen, bei der wir zwischen sozialen Zuständen, Lebensphasen oder psychischen Zuständen wechseln. In Afghanistan zum Beispiel waren Labyrinthe das Zentrum von Heiratsritualen, bei denen ein Paar seine Verbindung durch den Akt der Navigation auf dem gewundenen Steinpfad festigte. Labyrinthische Strukturen in Südostasien hingegen wurden als Meditationswerkzeuge verwendet, bei denen die Besucher langsam den Pfad entlang gingen, um ihre innere Konzentration zu vertiefen. In der Tat ist die archetypische Geschichte von Theseus, der den Minotaurus auf Kreta tötet, letztendlich eine Geschichte der Transformation: Theseus betritt das Labyrinth als Knabe und entsteigt als Mann und Held.
Lesen Sie: Die Wiederbelebung des Labyrinths
In ihrer modernen Inkarnation sind die meisten Labyrinthe zweidimensional, ihre Gänge werden durch niedrige Steinstapel oder in den Boden geflieste Mosaikmuster begrenzt. Aber wenn wir die Abstammung des Labyrinths tiefer in die Vergangenheit zurückverfolgen, auf der Suche nach früheren und früheren Inkarnationen, finden wir, dass die Wände langsam ansteigen, die Gänge dunkler und eindringlicher werden – tatsächlich waren die allerersten Labyrinthe fast immer unterirdische Strukturen. Die alten Ägypter, so berichtet Herodot, bauten ein riesiges unterirdisches Labyrinth, ebenso wie die Etrusker in Norditalien. Die vorinkanische Kultur von Chavín baute ein riesiges unterirdisches Labyrinth hoch in den peruanischen Anden, wo sie in dunklen, gewundenen Tunneln heilige Rituale durchführten; die alten Maya taten dasselbe in einem dunklen Labyrinth in der Stadt Oxkintok in Yucatán. In der Sonoran-Wüste von Arizona verehrt der Stamm der Tohono O’odham seit langem einen Gott namens I’itoi, auch bekannt als der Mann im Labyrinth, der im Herzen eines Labyrinths wohnt. Die Öffnung von I’itois Labyrinth, ein Muster, das häufig in die traditionellen Körbe des Stammes geflochten wird, soll der Eingang einer Höhle sein.
Als Jean-Luc Josuat-Vergès mit Whiskey und Schlaftabletten die Tunnel der Pilzfarm in Madiran betrat, hatte er Selbstmordgedanken. „Ich war niedergeschlagen, hatte sehr dunkle Gedanken“, so drückte er es aus. Nachdem er aus dem Labyrinth herauskam, stellte er fest, dass er sein Leben wieder in den Griff bekommen hatte. Er kehrte zu seiner Familie zurück, wo er sich glücklicher und wohler fühlte. Er begann, die Abendschule zu besuchen, erwarb einen zweiten Abschluss und fand einen besseren Job in einer Stadt am Ende der Straße. Als er nach seiner Verwandlung gefragt wurde, erzählte er Reportern, dass, während er in der Dunkelheit war, „ein Überlebensinstinkt“ eingesetzt hatte, der seinen Lebenswillen erneuerte. In seinem dunkelsten Moment, als er verzweifelt sein Leben verändern musste, reiste er in die Dunkelheit, gab sich der Orientierungslosigkeit hin und bereitete sich darauf vor, neu aufzutauchen.
Dieser Beitrag ist eine Adaption von Hunts neuem Buch, Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet.